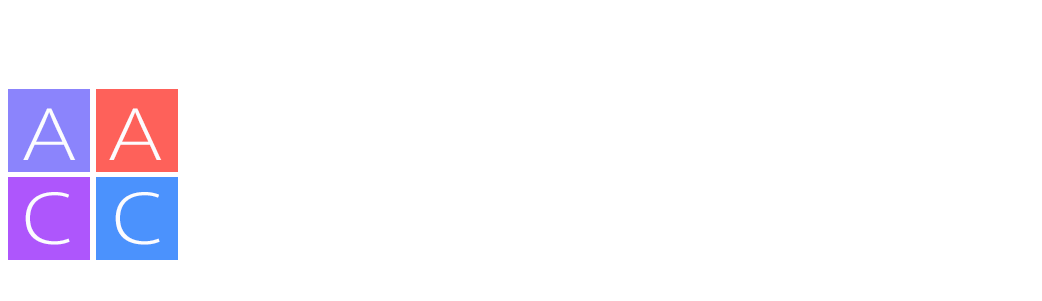Die Europawahlen von 06. bis 09. Juni haben durchaus zu Veränderungen der politischen Landschaft Europas geführt und in vielen Mitgliedstaaten für überraschende Ergebnisse gesorgt. Besonders Parteien rechts der Mitte konnten Wahlerfolge verzeichnen, während liberale und grüne Parteien die stärksten Verluste hinnehmen mussten.
Das mit 96 Abgeordneten am stärksten im EP vertretene Land ist Deutschland. CDU und CSU konnten gemeinsam 30 % der Stimmen auf sich vereinen und bleiben mit 29 Abgeordneten die stärkste Kraft in Deutschland. Die Alternative für Deutschland (AfD) erreichte mit 15,9 % der abgegebenen Stimmen den zweiten Platz und von 9 auf 15 Sitze im Parlament anwachsen. Die SPD erlebte mit 13,9 % ihr bisher schlechtestes Ergebnis und auch die Grünen müssen nahezu 9 % ihrer Stimmen einbüßen und kommen daher auf 11,9 %.
Folgenreich war das Wahlergebnis im zweitbevölkerungsreichsten EU-Land Frankreich. Hier konnte die rechtsnationale und europaskeptische Partei Rassemblement National unter der Führung von Marine Le Pen mit 31,4 % der Stimmen und 30 gewonnenen Sitzen einen klaren Sieg für sich verbuchen. Die Partei von Staatschef Emmanuel Macron, Renaissance, erreichte lediglich 14,6 % der Stimmen und landete damit deutlich hinter der Partei von Le Pen auf dem zweiten Platz. Die Sozialisten sicherten sich mit fast 14 % den dritten Platz.
Belgien erlebte parallel zu den Europawahlen auch Parlamentswahlen, bei denen rechte Parteien ebenfalls stark zulegten. In den Niederlanden hingegen gewann das Grün-Links Bündnis mit 21,6 % die Wahl. In Italien hat die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit ihrer Partei Fratelli d’Italia die Europawahl mit 28,8 % klar gewonnen und erhält damit 24 Mandatare. In Spanien ist die konservative Volkspartei PP mit 34,2 % der Stimmen stärkste Kraft geworden. In Finnland und Schweden hingegen setzten sich die Linken und Sozialdemokraten durch und gewannen den Wahlkampf.
Die Ergebnisse dieser Wahl führen zu einer veränderten Sitzverteilung im Europäischen Parlament. Diese Parteien können sich daraufhin einer Fraktion im Parlament anschließen, wobei es insgesamt 720 Sitze zu verteilen gibt. Die Fraktion der Europäische Volkspartei (EVP), welcher auch die ÖVP angehört, mit 189 Sitzen weiterhin die größte Fraktion im Europäischen Parlament stellen. Dies bedeutet für sie ein Plus von 13 Sitzen im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Die zweitstärkste Fraktion bleibt sozialdemokratische Fraktion S&D, mit voraussichtlich 135 Sitzen, darunter wie gehabt fünf der SPÖ. Im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode verlieren sie vier Sitze. Renew Europe, die Fraktion der auch die Neos angehören, verzeichnet den größten Verlust von 23 Sitzen und kommt auf 79 Mandatare. Die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), in der keine österreichische Partei vertreten ist, erhält siebenzusätzliche Sitze und liegt damit bei 76. Die Fraktion Identität und Demokratie (ID), zu der auch die FPÖ gehört, erhält neun zusätzliche Abgeordnete und kommt auf insgesamt 58 Sitze. Den vorletzten Platz belegen die Grünen, welche einen starken Verlust von 18 Sitzen zu verzeichnen haben und lediglich von 53 Abgeordneten vertreten werden. Beobachter begründen dies vor allem mit dem Wahlverhalten junger Wähler welche die Fraktion vor fünf Jahren die Partei zu einem großen Wahlerfolg trugen. Die Fraktion der Linken, in der keine österreichische Partei vertreten ist, bildet mit 39 Sitzen das Schlusslicht. Eine große Anzahl von Abgeordneten, aktuell 91, gehören darüber hinaus (noch) keiner Fraktion an. Bei den nun anlaufenden Treffen der einzelnen Fraktionen soll auch über etwaige Aufnahmen oder Fraktionsneugründungen verhandelt werden.
Die Wahlbeteiligung in der gesamten EU lag bei 51 % und war somit nahezu identisch mit der des Jahres 2019 (50,66%). Die höchste Wahlbeteiligung wurde mit fast 90 % in Belgien verzeichnet, was auf die dortige Wahlpflicht zurückzuführen ist. Ebenfalls sehr hoch war die Wahlbeteiligung in Luxemburg mit 82 % und dem Mitgliedstaat mit den wenigsten Sitzen, Malta, mit 73 %. Auffallend niedrig war die Wahlbeteiligung im jüngsten Mitgliedstaat Kroatien mit erschütternden 21 %. Sehr gering war die Wahlbeteiligung auch in Litauen mit 28 %, sowie in Lettland und Bulgarien mit jeweils 33 %. In Österreich lag die Wahlbeteiligung mit 56,30% etwas unter dem Wert von 2019 (59,80%).